
Das Niederländische ist dem Deutschen sehr nahe verwandt. Doch im Nachbarland will man sprachliche Gerechtigkeit ganz anders herstellen, erklärt unser niederländischer Gastredakteur: Auch für Frauen gebrauchen immer mehr Medien die maskuline Form. Die Begründung könnte deutsche Gender-Befürworter verunsichern.
Dit is een oorspronkelijk Duitstalig artikel. De Nederlandse vertaling volgt binnenkort
Dass Gendern ein Ding ist, habe ich nicht gewusst. Wenn Sie sich jetzt fassungslos fragen, wo ich all diese Zeit gelebt habe, dann lautet die Antwort: in den Niederlanden. Als internationaler Gastredakteur beim WELT-Feuilleton erfahre ich die Aufregung deswegen als etwas völlig Neues. Dennoch sieht mein Lebenslauf ziemlich deutsch aus. Aufgewachsen in der Grenzstadt Venlo, Sohn einer Mutter aus der Eifel, als Kind bekannt mit der „Sendung mit der Maus“ und Max und Moritz. Bis heute lese ich regelmäßig Deutsch (Ach, die Gereon-Rath-Romane von Volker Kutscher!). Aber Gendern?
Klar, die Deutschlandkorrespondenten der niederländischen Zeitungen haben ab und an über neu erfundene Wörter geschrieben, die Frauen sichtbarer machen sollten in der Sprache, über Schrägstriche, Binnen-I, Gendersternchen und Doppelpunkte mit -innen dahinter. Ihre Berichte lasen sich wie Entertainment. Kuriositäten. Trends vorübergehender Art.
Mehr als ein Trend
Aber so ist es nicht, weiß ich jetzt. Die deutschen Journalisten, die an demselben Austauschprogramm teilnehmen wie ich und jetzt in niederländischen Redaktionen tätig sind, haben mich schon vor der Debatte um das Gendern gewarnt. Am ersten Arbeitstag beim Feuilleton begegnete ich dem Kollegen Matthias Heine (den ich übrigens kannte, ohne es zu wissen, denn vor sieben Jahren telefonierte ich mit ihm für diesen Artikel über sein hervorragendes Buch), ein erklärter Gender-Gegner. Recherchen zeigten, dass der Kampf in Deutschland seit Jahren tobt („Verteidigung ist nötig“, schrieb Sprachwissenschaftler Horst Haider Munske Mitte März noch in einem vielgelesenen WELT-Artikel), inklusive einem offiziellem Genderverbot für Behörden im Bundesland Bayern. In den Niederlanden gibt es so was nicht. Klar, auch da streben Progressive eine geschlechtergerechtere Sprache an. Aber dazu erfinden sie keine neuen Wörter für Frauen – sie werfen die alten raus.
Liebe Reisende
In verschiedenen Wellen haben Vorkämpfer der Emanzipation in den Niederlanden Wege gesucht, in der Sprache Frauenrechte zu wahren und zu stärken. (Dies spielt ebenfalls in anderen niederländischsprachigen Gebieten eine Rolle, etwa in Flandern, aber davon ist hier nicht die Rede.) Mitte der 2010er-Jahre kam es erneut zu einer Eruption. Den berüchtigtsten Fall gab es bei der Bahn. Die Nederlandse Spoorwegen traf 2017 die Entscheidung, ihre Passagiere in Zügen und auf Bahnhöfen über Lautsprecher nicht mehr mit „beste dames en heren“ (Liebe Damen und Herren) anzureden, sondern bloß mit „beste reizigers“ (Liebe Reisende). Die Behörde der Hauptstadt riet ihren Beamten, künftig von „Amsterdammers“ zu reden.
Genauso wie in Deutschland handelte es sich in vielen Fällen um das generische Maskulinum, also das Substantiv, das grammatisch männlich ist, aber verallgemeinernd verwendet wird. Jetzt wurde immer häufiger eigenaar (Inhaber) bevorzugt gegenüber eigenaresse (Inhaberin) und huisgenoot (Hausgenosse) gegenüber huisgenote (Hausgenossin).
Nur noch Moderator
Auffallender waren die Veränderungen in Berufsbezeichnungen – wiederum wie im Deutschen. Das niederländische Medienmagazin „VARAgids“, für das ich arbeite, benutzt seit einigen Jahren in seinen Artikeln nicht mehr presentatrice (Moderatorin), lange ein geläufiges Wort, sondern nur presentator (Moderator). Kürzlich gewahrte ich in der Bildunterschrift zu einem Foto einer berühmten actrice (Schauspielerin) die maskuline Benennung acteur (Schauspieler).

Gleiches Ziel, unterschiedliche Mittel
Auch die großen Tageszeitungen machten mit. „De Volkskrant“ zum Beispiel verwendet seit 2016 nicht mehr fotografe (Fotografin), lerares (Lehrerin) oder directrice (Direktorin), sondern nur noch fotograaf (Fotograf), leraar oder leerkracht (Lehrer oder Lehrkraft) und directeur (Direktor). Gesetze oder Verbote von oben hat es bisher nicht gegeben. Die Taalunie, die internationale amtliche Organisation für die niederländische Sprache, veröffentlichte 2022 Hinweise zugunsten des „genderbewust taalgebruik“ (genderbewussten Sprachgebrauchs). Sie haben es verstanden: Während im Deutschen versucht wird, eine geschlechter- oder gendergerechtere Sprache zu schaffen, indem man neue, vor allem weibliche Wörter hinzufügt, wird im Niederländischen genau das gleiche Ziel dadurch angestrebt, dass man die weiblichen Formen entfernt.
Еng verwandte Sprachen
Zwar nannte Angela Merkel sich einst „Physiker“ und wollen Soldatinnen der Bundeswehr weiterhin „Leutnant“ genannt werden, aber der Trend hierzulande geht jetzt in die andere Richtung. Wie ist das möglich? Die westgermanischen Sprachen Deutsch und Niederländisch sind eng miteinander verwandt. Der Online-Sprachenvergleicher eLinguistics beschreibt die Beziehung zwischen den beiden als „very closely related!“ (Bewertung: 13,5 Punkte). Das ist eine bedeutend engere Beziehung als zu dem ebenfalls westgermanischen Englisch (31,3 Punkte, „closely related“), zur romanischen Sprache Französisch (55,7 Punkte, „related“) oder zum kiptschakischen Kirgisisch (87,9 Punkte, „not related“). Welche Überlegungen stecken hinter den linguistischen Entscheidungen in den Niederlanden?
Die Chefredakteurin wollte lieber Chefredakteur sein
Chefredakteurin
„Persönlich finde ich es sehr merkwürdig, dass wir aus allen Identitäten, über die wir als Menschen verfügen, in den vergangenen Jahrhunderten das Gendern selektiert haben, um eine sprachliche Variation zu bilden“, sagt Roy van Vilsteren, Chefredakteur von „VARAgids“. „Lasst uns anno 2025 damit aufhören. Wir glauben, dass es keine Rolle spielen sollte, wer unser Brot backt oder wer irgendetwas studiert.“
Vor etwa zehn Jahren fingen die Redakteure der Zeitschrift aus Hilversum an, über die Sache nachzudenken. Die damalige Chefredakteurin nannte sich nur ungern hoofdredactrice – sie bevorzugte die männliche Form hoofdredacteur, die neutraler sei. „Wir haben uns dafür entschieden, die weiblichen Varianten zu streichen“, erzählt van Vilsteren, der diese „eine Ableitung der männlichen Form“ nennt. Er will einen Standard setzen, gibt der Chefredakteur zu – und keinen konservativen. „Wir machen unser Magazin für BNNVARA, einen progressiven Rundfunk.“
Er versuche, im Großen und Ganzen dem allgemeinen Sprachgebrauch zu folgen, meint mit schrijver (statt schrijfster) aber sowohl Schriftsteller als auch Schriftstellerinnen, obwohl viele Leser bei dem Maskulinum zuerst an einem Mann denken. Die Ausnahmen betreffen Einzelfälle, in denen das Geschlecht der betreffenden Person doch eine Rolle spielt, wie bei acteur und actrice. „In dem Beruf tut es ja etwas zur Sache, ob es um einen Mann oder eine Frau geht. Und man sieht es auch gleich. Ist das in einerBildunterschrift mal schiefgegangen? Kann sein. Das weiß ich nicht mehr.“
Stilbuch
„,De Volkskrant‘ strebt die Gleichstellung der Geschlechter im Sprachgebrauch an. Vermeiden Sie daher Konstruktionen, die den Eindruck erwecken, das Männliche sei die Norm und das Weibliche die Ausnahme“, so schreibt die Tageszeitung in ihrem Stilbuch. In den meisten Fällen „sollte der weibliche Ausgang (-e, -in, -es, -ster, -trice) vermieden werden.“ Chris Buur, stellvertretender Chefredakteur, erkennt an, dass diese Methode als willkürlich gesehen werden kann. „Wir hätten überall eine weibliche Form hineinbauen können, aber wir meinen gerade, dieser Unterschied sei sexistisch. Deswegen benutzen wir nur eine Form, die männliche.“
Dass die neutrale grammatisch männliche Form auch geeignet ist für Personen, die sich als nichtbinär identifizieren, war damals nicht vorgesehen. Buur nennt es „einen glücklichen Beifang“ – die Form fühle sich für Niederländischsprachige einfach meist neutral an. „Aber wir versuchen, die Sprache zu ändern. Je öfter unsere Abonnenten lesen, dass ein conducteur (Schaffner) eine Frau ist, desto schneller verschwindet die Assoziation, es sei ein Mann.“
In Zweifelsfällen gilt etwas, das Buur „das Lächerlichkeitsprinzip“ nennt
Lächerlichkeitsprinzip
In Zweifelsfällen gilt etwas, das Buur „das Lächerlichkeitsprinzip“ nennt: Wenn eine genderneutrale Variante sich einfach zu grotesk anhört, sollte ein Journalist die traditionelle Bezeichnung benutzen. Auch bei „de Volkskrant“ ist eine actrice noch immer eine actrice. „Manchmal ist die Lösung unlogisch. Sprache ist keine Mathematik.“ Böse Leserbriefe bekommt „de Volkskrant“ jedoch kaum noch mehr, sagt er.
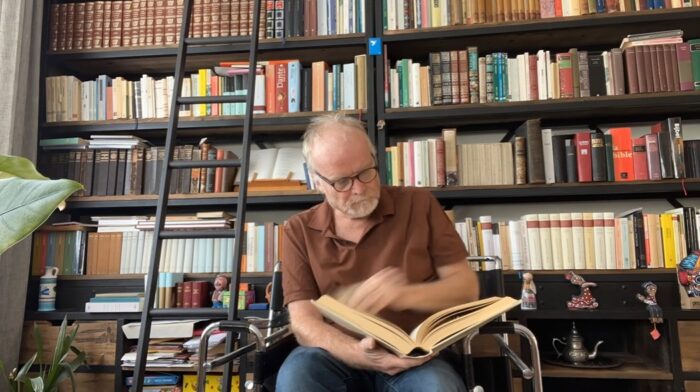
Male bias
Auch Marc van Oostendorp sieht in Bezug auf Berufsbezeichnungen keine heftige Debatte in den Niederlanden. Der Professor für niederländische und akademische Kommunikation an der Universität von Nimwegen beobachtet dennoch, dass eine Gruppe Feministen sich sperrt gegen die neue genderneutrale Sprache. „Die nennen sich docente (Dozentin) und nicht docent (Dozent), weil sie sichtbar machen möchten, dass auch Frauen im Unterricht tätig sind.“
Ob der Weg der niederländischen Medien der bessere ist, oder jener der Feministen, kann er nicht sagen. „Ich habe keine deutliche Meinung in dieser Sache, ich verstehe die Argumente beider Seiten. Und die Tatsache, dass Menschen sich beim Nennen einer Person eher einen Mann vorstellen, ist wissenschaftlich geprüft – sogar beim Wort Mensch. Das heißt ,male bias’ und gibt es in allen Kulturen.“ Ob man so was ändern kann, weiß er auch nicht. „Sogar die Finnen haben einen ‚male bias‘, mit ihrer relativ emanzipierten Kultur. Und ihrer Sprache, die kein er oder sie kennt, nur das neutrale hän.“
Wieso diese Emotionen?
Auseinandersetzungen über Personalpronomen hat es in den Niederlanden gegeben, in Deutschland aber kaum. Hier ruft die Anwendung des generischen Maskulinums heftige Emotionen hervor. Warum das so ist? Und warum deutsche Progressive sich für mehr weibliche Wörter entschieden haben, während ihre Geistesverwandten im Nachbarstaat sie so schnell wie möglich loswerden möchten? Darüber wagt van Oostendorp es schon, eine begründete Vermutung zu äußern. „In der deutschen Sprache spielt das grammatische Geschlecht eine viel größere Rolle. Sie zählt drei Genera und die Unterschiede sieht man in Artikeln, Adjektiven und Substantiven. Deutschsprachige müssen also oft eine Entscheidung treffen in diesem Bereich, Niederländischsprachige nicht.“ Auf Niederländisch meint der Artikel de sowohl er als sie. Het ist das. Mit een goede professor kann ein guter Professor gemeint sein oder eine gute Professorin.
Vielleicht konzentriert die Sprachkultur in Deutschland sich mehr auf die Regeln der geschriebenen Standardsprache
„Zweitens könnte die Haltung zur Sprache eine andere sein“, vermutet van Oostendorp. „Paulien Cornelissen und Wim Daniëls, die beliebtesten Publizisten in Sache Niederländisch, sind liberale Leute. Sie feiern die Vielfalt der Umgangssprache, sind begeistert von neuen Entwicklungen. Ich bin kein Deutschland-Experte, aber bei unseren Nachbarn kommt mir das undenkbar vor. Mir fallen Wehklagen auf über den Verlust des Genitivs und so. Vielleicht konzentriert die Sprachkultur in Deutschland sich mehr auf die geschriebene Standardsprache, die Regeln kennt, für die man sein Bestes tun soll.“ Er lacht. „Ich weiß, das hört sich an wie Klischees. Als Sprachwissenschaftler kann ich nur denken: Was hier alles passiert, ist unheimlich interessant.“
Dieser Artikel wurde veröffentlicht in der WELT
“Gendern” mit männlicher Form:
Darauf bestanden berufstätige Frauen in der DDR.
Ihren Bericht beachte ich bei eigenem entstehenden Aufsatz zu Rechtsfragen des “G.”.
Interessieren diese Sie?